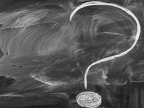Zum 50. Geburtstag Wertvoll und unverzichtbar
-

- Der Deutschlandfunk steht seit 50 Jahren für schnörkellose Information aus Politik, Wirtschaft und Kultur
Am 1. Januar 1962, 16.00 Uhr, hielt Gründungsintendant Hermann Franz Gerhard Starke eine kurze Ansprache, es folgten die ersten Nachrichten. Der Deutschlandfunk war auf Sendung.
Am Abend sprach der Bundespräsident. Wenige Monate nach der Errichtung der Berliner Mauer formulierte Heinrich Lübke: "Man kann jene Mauer (...) höher oder stärker machen; man kann eine zweite und dritte ziehen, den letzten Fluchtweg blockieren oder selbst einen festtäglichen Besuch von Kindern bei ihren Eltern unterbinden: Noch aber gibt es Ätherwellen, die von uns zu Ihnen hinüberreichen, die ein verbindendes Wort zu Ihnen bringen sollen, ein informierendes, ein erleichterndes oder auch ein tröstendes."
Heinrich Lübke brachte den Gründungsauftrag des Deutschlandfunks auf den Punkt: eine Funkbrücke zu sein, über Mauer und Stacheldraht hinweg in den anderen Teil Deutschlands, der sich mit der immer perfekteren Ummauerung anschickte, die deutsche Teilung zu armieren und das Gemeinsame zu trennen und zu unterdrücken..
Laut Bundesgesetz vom 29. November 1960 war der Auftrag des Deutschlandfunks, in einem deutschsprachigen und einem mehrsprachigen Europa-Programm, ein „umfassendes Bild Deutschlands“ zu vermitteln. Ein anspruchsvoller, aber auch interpretationsfähiger Auftrag. Was zeichnet einen „Wiedervereinigungssender“ mit einem „Integrationsauftrag“ aus?
 Deutschlandradio Intendant Dr. Willi SteulDer Deutschlandfunk definierte sich von Beginn an über die Information. Intendant Starke versprach den Menschen jenseits der innerdeutschen Grenze „die entpolemisierte und entgiftete Wahrheit“. Die Hörer in Ostdeutschland sollten von unabhängigen, freien Journalisten über politische und kulturelle Entwicklungen informiert werden. In dem zunächst nur über Mittel- und Langwelle ausgestrahlten 24-Stunden-Vollprogramm bildeten ausführliche Nachrichten den Kern.
Deutschlandradio Intendant Dr. Willi SteulDer Deutschlandfunk definierte sich von Beginn an über die Information. Intendant Starke versprach den Menschen jenseits der innerdeutschen Grenze „die entpolemisierte und entgiftete Wahrheit“. Die Hörer in Ostdeutschland sollten von unabhängigen, freien Journalisten über politische und kulturelle Entwicklungen informiert werden. In dem zunächst nur über Mittel- und Langwelle ausgestrahlten 24-Stunden-Vollprogramm bildeten ausführliche Nachrichten den Kern.
Als erste deutsche Rundfunkanstalt setzte der Deutschlandfunk 1964 die Nachrichten im Stundentakt. Dazwischen standen hauptsächlich Programme über Politik und Wirtschaft. Kultursendungen nahmen etwa ein Drittel der Sendezeit ein. Neben die aktuelle Berichterstattung wurde eine Vielzahl an Fach- und Hintergrundsendungen gesetzt. Im Stil der Zeit aber auch Unterhaltungs- und vor allem Musik-Wunschsendungen, die eine Gruß-Brücke zwischen Ost und West schlagen sollten.
Der Deutschlandfunk richtete sich in den ersten zehn Jahren vornehmlich an die Bürger in der DDR. Erst in den 70er Jahren erhielt der Deutschlandfunk erstmals UKW-Frequenzen und wurde im westlichen Teil Deutschlands besser empfangbar, auch im Raum Bonn. Damit gewann er immer stärker an Gewicht als herausragendes Programm zur politischen und kulturellen Information. Schon 1989 wurden neben die stündlichen Nachrichten auch Nachrichten zur halben Stunde gesetzt.
Mit der Öffnung der Mauer 1989 brach das DDR-System zusammen
Am 1. Januar 1992 wurde mit dem Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten Deutschland die Vereinheitlichung des Rundfunkwesens für das gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland endgültig vollzogen. In der ehemaligen DDR gründeten sich Landesrundfunkanstalten der ARD. Der Auftrag an den Deutschlandfunk war mit der von den Menschen erzwungenen Maueröffnung und der danach folgenden Wiedervereinigung Deutschlands nur auf den ersten Blick und nur zum Teil entfallen. Die Aufgabe stellte sich nun verändert: Es gilt heute, die Menschen in ganz Deutschland über die Politik und das kulturelle Geschehen aus allen Ländern zu informieren.
So war es folgerichtig, nach einem weiteren zweijährigen Klärungsprozess, 1994 den Deutschlandfunk (Köln) mit dem Berliner RIAS und dem ehemaligen DDR-Programm Deutschlandsender Kultur unter einem Dach im neu gegründeten "Deutschlandradio" zu vereinigen. Mit dieser ersten Fusion im öffentlich-rechtlichen Rundfunk entstand in Deutschland als neues Medienunternehmen ein nationaler Hörfunk.
Im Deutschlandradio und neben Deutschlandradio Kultur (Berlin) - seit 2010 auch neben DRadio Wissen, das digitale Programm über Internet, Satellit, Kabel und DAB - wurde der Deutschlandfunk seit 1994 strategisch weiter zum führenden Informationsprogramm in Deutschland ausgebaut. Die aktuellen Sendungen, nicht nur die wichtigen „Informationen am Morgen“, wurden erweitert und auf das Wochenende ausgedehnt, neue Sendungen für junge Hörer wie „Campus & Karriere“ oder „Corso“ wurden entwickelt. Der Wortanteil des Programms beträgt rund 75 Prozent, ein Vollprogramm auch mit einem starken Angebot an journalistisch aufbereiteter Kultur. Es entstanden Konzertreihen (Grundton D, Raderberg-Konzerte, Forum Neuer Musik), in denen neben der Darbietung von Musik die journalistische Information über die Musik steht. Trotz zunehmender Konkurrenz hat der Deutschlandfunk dabei kontinuierlich mehr Hörer angezogen. Er wird derzeit von 6,4 Millionen Menschen regelmäßig und fast 1,6 Millionen Menschen täglich gehört.
Galerie















50 Jahre Deutschlandfunk sind ein Grund zum Feiern. Wir tun dies aber nicht mit einer „klassischen“ Feierstunde. Sondern wir denken öffentlich und zusammen mit hochkarätigen Gesprächspartnern über den Kern unserer Tätigkeit nach. „Der Ort des Politischen in der digitalen Medienwelt“, so lautet der Titel unseres Kongresses in Köln am 6. und 7. Januar.
Wie vermittelt man in Zeiten des rasanten multi-medialen Wandels „das Politische"?
„Das Politische“ ist mehr als die Aktualität, dies ist auch das weite Feld der Kultur und der gesellschaftlichen Phänomene. Es ist all das an Wissen und Informationen, was wir in immer komplexer werdenden gesellschaftlichen Zusammenhängen zu unserer eigenen Entscheidungsfindung benötigen und dessen Vermittlung der Kern unseres Auftrages ist.
Der stolze Blick zurück muss gestattet sein. Doch entscheidend ist die Zukunft. In der Deutschlandradio weiterhin ein Sender mit Programmen bleiben muss, die von den Menschen als wertvoll und als unverzichtbar erachtet werden. Programme, deren Angebote relevant sind.